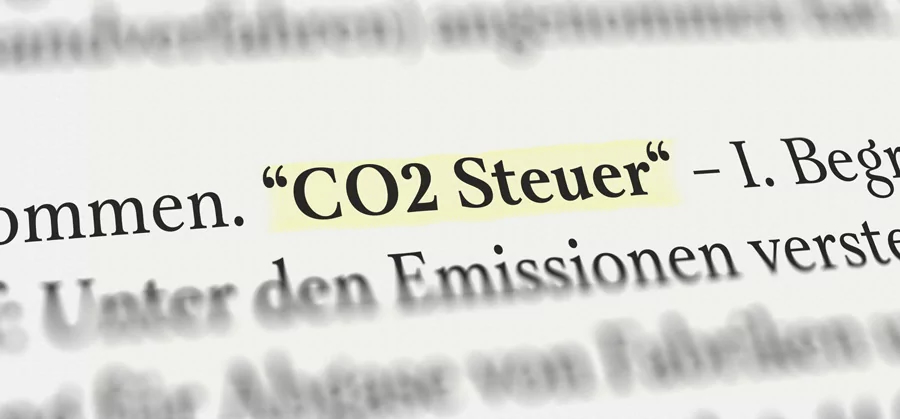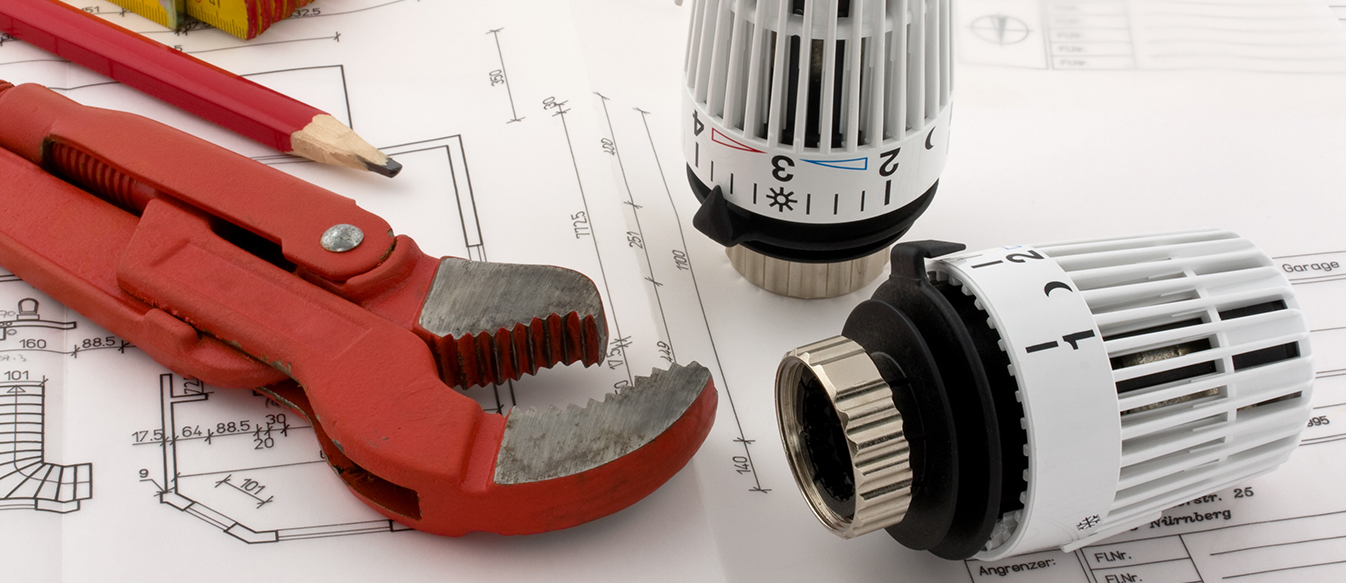Umsetzung:
In der Regel liegt die Berechnung und Verteilung der Kohlendioxidkosten in der Verantwortung der Vermieterin bzw. des Vermieters und wird im Rahmen der Betriebskostenabrechnung durchgeführt. Mieterinnen und Mieter, die sich selbst mit Wärme und Warmwasser versorgen – beispielsweise über Gasetagenheizungen – führen die Berechnung und Verteilung anhand der Rechnungen ihres Energieversorgers eigenständig durch und fordern ihre Vermieterin bzw. ihren Vermieter auf, den Anteil an den Kohlendioxidkosten zu erstatten.
Hintergrund der Änderung:
Durch die Gesetzesanpassung sollen die Vermieterinnen und Vermieter dazu motiviert werden, den energetischen Zustand ihrer Gebäude zu optimieren und diese mit klimafreundlichen Heizsystemen auszustatten. Denn nur durch die Investition in energetische Sanierungen wie zum Beispiel zu klimaschonenden Heizungssystemen können sie ihren Anteil an den CO2-Kosten senken.
Rechtsgrundlage für diese Entlastung der Mieterinnen und Mieter ist das Gesetz zur fairen Aufteilung der CO2-Kosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz).
Wie hat sich die „CO2-Steuer“ bisher ausgewirkt?
Verbraucherinnen und Verbraucher fossiler Energieträger konnten die Auswirkungen der „CO2-Steuer“ direkt am Preis für ihre Energie beobachten. Gerade zu den Jahreswechseln, die mit der Erhöhung der CO2-Bepreisung einhergingen, kam es in vielen Fällen zu Preissprüngen.
Weniger offensichtlich sind zwei positive Auswirkungen der „CO2-Steuer“: Einerseits fließen die Einnahmen unter anderem in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung. Der CO2-Preis sichert damit die Finanzierung von Investitionen in die Dekarbonisierung, zu denen auch viele Förderprogramme für die Gebäude- und Verkehrswende gehören.
Zum anderen kann der Rückgang von CO2-Emissionen verschiedener Länder auch auf die Einführung von CO2-Steuern und dem Emissionshandel zurückgeführt werden, so eine Studie, die vom Berliner Klima-Thinktank MCC (heute RD5, Teil des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung) geleitet wurde. Damit erfüllt die CO2-Bepreisung ihren primären Zweck: Die Reduzierung von CO2-Emissionen und damit den Schutz des Klimas.
Wie kann ich an der „CO2-Steuer“ sparen?
Zum einen können Verbraucherinnen und Verbraucher zum Heizen einen Energieträger verwenden, der im Vergleich zu anderen Brennstoffen geringere CO2-Emissionen verursacht. Zum Beispiel Flüssiggas statt Heizöl: Wegen der unterschiedlichen Menge an CO2-Emissionen, welche die beiden fossilen Energieträger verursachen, unterscheidet sich auch deren CO2-Bepreisung.
Nachfolgend ein Vergleich für den Jahresenergiebedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses zum Heizen und die Warmwasserbereitung von 20.000 kWh bei der CO2-Bepreisung für das Jahr 2026 von 55 €, 60 € und 65 € pro Tonne CO2 inklusive Mehrwertsteuer: