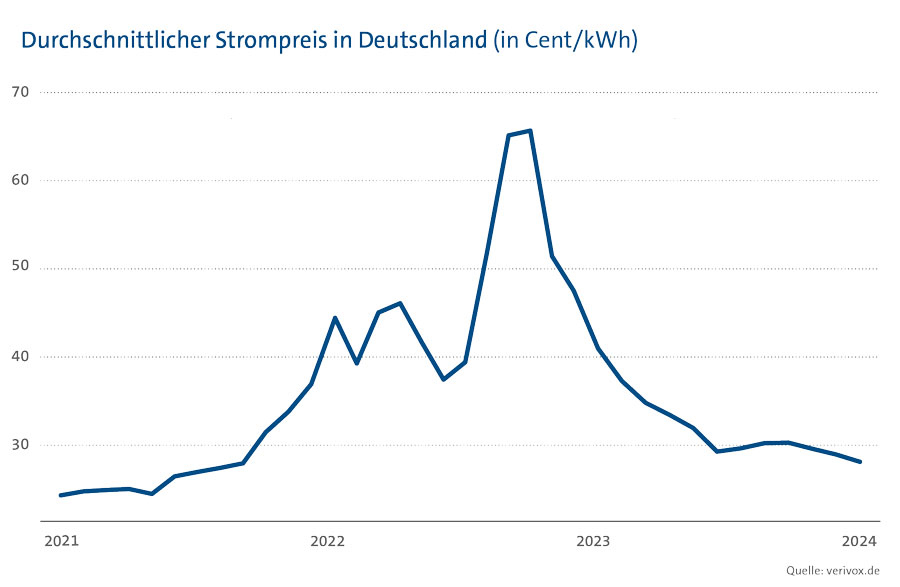Welche Technologien ermöglichen eine autarke Energieversorgung?
Inzwischen stehen Interessenten an einer autarken Energieversorgung diverse Technologien zur Verfügung, die auch problemlos miteinander kombiniert werden können:
BHKW
Ein BHKW (Blockheizkraftwerk) produziert sowohl Strom als auch Wärme – und das besonders effizient. Es arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung: So wird der Energieträger (meist Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl) verbrannt, um einen Motor anzutreiben. Über einen Generator wird Strom erzeugt. Außerdem entsteht dabei Abwärme, die zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt wird.
BHKW werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, die sich vor allem in der Kompatibilität mit Energieträgern und der Leistung voneinander unterscheiden. In der Regel lohnt sich die Investition in ein Blockheizkraftwerk für Privathaushalte und Betriebe, deren jährlicher Strombedarf 20.000 Kilowattstunden und der Wärmebedarf 50.000 Kilowattstunden übersteigt. Zum Vergleich: Der Durchschnittsbedarf eines regulären Vierpersonenhaushalts umfasst etwa 4.000 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Energie fürs Heizen und die Warmwasserbereitung.
Durch den Einsatz eines hocheffizienten BHKW in Verbindung mit Flüssiggas lassen sich gegenüber der konventionellen Wärmeerzeugung mit Heizöl Emissionen deutlich reduzieren. Hinzu kommen Fördermittel sowie der eigene Strom. Einzelne Hersteller fördern den Umstieg durch attraktive Wechselpakete.
Wer die Emissionen des Flüssiggas-BHKW noch weiter reduzieren möchte, setzt auf die biogene Flüssiggas-Variante. Weitere Infos über flüssiggasbetriebene Blockheizkraftwerke im Allgemeinen geben wir Ihnen auf unserer Seite Flüssiggas-BHKW. Erfahren Sie außerdem, wie die Benediktinerabtei Rohr ihre autarke Energieversorgung mithilfe eines BHKW deutlich klimaschonender gestalten konnte.
Photovoltaik/Solarthermie
Photovoltaikanlagen erzeugen mittels Sonnenenergie Strom, Solarthermieanlagen Wärme. Grundvoraussetzung für die Installation beider Anlagenarten ist eine ausreichend große Dachfläche – je größer sie ist, desto mehr Solarkollektoren können entsprechend dem Bedarf darauf platziert werden –, die im Idealfall nach Süden ausgerichtet und zu 45 Grad geneigt ist.
In Deutschland gelangen auf einen Quadratmeter ebenen Bodens jährlich über 1.000 Kilowattstunden Sonnenenergie. Doch auch unter perfekten Voraussetzungen hängt die Energieausbeute stark von der Witterung am Standort ab – und von der Anlagengröße sowie den installierten Modellen.
Überschüssig erzeugter Strom kann ins öffentliche Netz eingespeist werden, sofern ein Anschluss besteht.
Kombination mehrerer Technologien
Für eine autarke Versorgung mit Strom und Wärme kann die Kombination mehrerer unterschiedlicher Technologien sinnvoll sein. Unter anderem:
- BHKW + Photovoltaikanlage
- BHKW + Solarthermieanlage
Kombinationen wie diese bieten ihren Nutzern gleich mehrere Vorteile; zum Beispiel die erhöhte Produktion von Strom und/oder Wärme für Gebäude mit sehr hohem Bedarf. Zudem reduziert die Einbindung mehrerer Energiequellen inklusive erneuerbarer Energien das Ausfallrisiko der autarken Energieversorgung. Da Photovoltaik und Solarthermie nur tagsüber bzw. bei Sonneneinstrahlung Energie erzeugen, können dauerhaft arbeitende Anlagen wie BHKW eine konstante Versorgung mit Strom und Wärme gewährleisten und die Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien somit ideal ergänzen. Auch eine flüssiggasbetriebene Gas-Hybridheizung bietet sich für eine autarke Energieversorgung an. Mehr darüber erfahren Sie in unserem Video auf der Seite Gas-Hybridheizung: In diesen Fällen lohnt sie sich.
Zusätzliche Komponenten
Für eine autarke Energieversorgung sind beispielsweise außer der KWK-Anlage weitere Geräte notwendig. Zum Beispiel:
- Batteriespeicher, der überschüssig produzierte elektrische Energie auf Reserve hält
- Energiemanagementsystem, das die Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme regelt und dadurch eine unterbrechungsfreie Versorgung gewährleistet